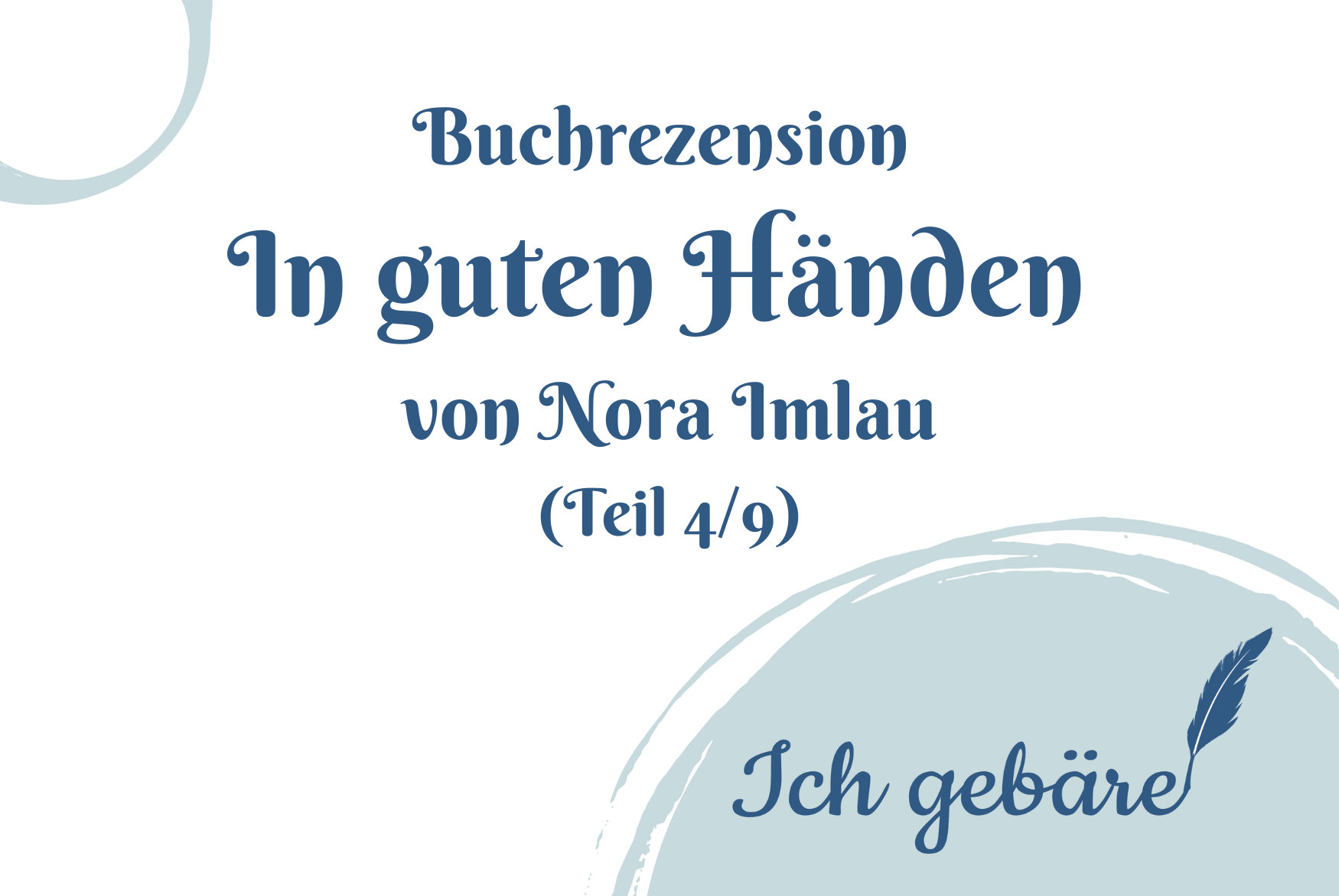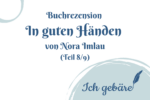Heute geht es weiter mit Teil 4 meiner Buchrezension zu Nora Imlaus Buch In guten Händen. Die vorigen Buchrezensionen findest du weiter unten verlinkt.
Als Service für dich verlinke ich in meinen Beiträgen Produkte oder Dienstleistungen. Manchmal sind das Affiliate-Links. Ich erhalte also eine Provision, ohne dass du mehr zahlst. Affiliate-Links sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
Um denjenigen gerecht zu werden, die sich mit den Worten „Frau“ oder „Mutter“ nicht identifizieren können, obwohl in ihrer Geburtsurkunde „weiblich“ steht, habe ich mich dazu entschlossen, in meinen eigenen Beiträgen „Mutter“ und „Frau“ jeweils mit dem Inklusionssternchen zu versehen. Ihr werdet also Frau* oder Mutter* lesen (falls der Text von mir kommt und nicht von anderen Menschen). Geschlechtergerechte und inklusive Sprache ist mir ein Herzensthema, allerdings ist (meine persönliche und die gesellschaftliche) Entwicklung dazu noch lange nicht abgeschlossen. Mal sehen, wie ich es in Zukunft angehe. Mehr zum Thema liest du unter anderem hier: Sollte ein Geburtsblog geschlechtsneutral sein, Gebären wie eine Feministin und Sex, Gender, Geburten und die deutsche Sprache.
In guten Händen: Bisherige Rezensionen
Im blauen Kasten findest du eine Übersicht der einzelnen Blogposts, in denen ich mich mit In guten Händen befasse. Bereits veröffentlichte Posts sind verlinkt, wenn die Technik mitspielt.
In guten Händen: Alle Teile der Rezension
(bitte zum Lesen aufklappen)

- Teil: (hier lesen)
- Überblick
- Einleitung
- Kapitel 1: Ein Dorf für uns und unser Kind
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 2: Auf die Bindung kommt es an
- Kapitel 3: Familie und Freundeskreis (Einleitung, Bezugspersonen von Babys)
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 3: Familie und Freundeskreis (Fortsetzung bis Kapitelende)
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 4: Was prägt uns in der Betreuungsfrage? Eine Spurensuche
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 5: Unseren Weg als Familie finden
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 6: Ein guter Ort für unser Kind
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 7: Es geht los
- Teil:
- Kapitel 8: Neue Beziehungen: Schule und Kinderfreundschaften
- Teil:
- Der Schluss: Ein Netz, das trägt
- Meine Meinung: In guten Händen
- Fazit
Kapitel 4: Was prägt uns in der Betreuungsfrage? Eine Spurensuche
In diesem Kapitel geht Nora Imlau der Frage nach, warum wir eigentlich bestimmte Überzeugungen haben in Bezug auf das, was Kinder brauchen. Direkt in der Einleitung schreibt sie einen Satz, der für viele Themen des Lebens gilt und den ich unbedingt herausstellen möchte. Denn auch in Bezug auf Geburten ist das Thema extrem relevant:
Doch anders als viele glauben, ist unser viel gerühmtes Bauchgefühl eben keine Quelle verborgener Wahrheit, sondern eine ziemlich wilde Mischung aus Prägungen und Erfahrungen, Gehörtem, Gelesenem und Erlebtem, was in der Summe deutlich weniger verlässlich ist, als das allgegenwärtige Lob der elterlichen Intuition uns oft denken lässt.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 135
Sie macht auch deutlich, dass diese Prägungen auch beeinflussen, wie wir nach Informationen suchen und welche Art von Quellen wir als vertrauenswürdig empfinden. Diese Art der selektiven Informationsaufnahme macht selbst vor universitären Studien nicht halt. So ist es auch aus Sicht der Autorin keinesfalls verwunderlich, dass auch zum Thema Betreuung außerhalb der Kernfamilie „Kronzeug*innen mit Doktor- und Professorentitel“ auftreten, die ihre Sicht der Dinge (wahlweise „Kinder verdummen zu Hause“ oder „Kinder verwahrlosen in Krippen“) propagieren.
Zwischen DDR- und BRD-Erfahrungen
Spannend ist es, auch in diesem Fall auf die Schere zwischen Ost- und Westdeutschland zu achten. So berichtet die Autorin, dass sich Eltern in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eher dafür rechtfertigen müssen, wenn ihr kleines Kind nicht außerhalb der Familie betreut wird, während Eltern in den anderen Bundesländern sich eher dafür rechtfertigen müssen, wenn sie ihre kleinen Kinder nicht zu Hause betreuen.
Manifest für eine selbstbestimmte Geburtskultur

Die Autorin gibt danach einen Einblick in die Erfahrungen derjenigen Menschen, die in der DDR in einer Krippe betreut wurden. Sie schreibt von dem Anspruch, die Krippen als topmoderne Bildungseinrichtungen zu etablieren, aber auch vom Anspruch, dass wirklich jede Mutter* kurz nach der Geburt wieder ins Erwerbsleben eintrat. Ob die betreuten Kinder die Zeit als angenehm oder unangenehm empfanden, ist sehr unterschiedlich. Manche empfanden die Zeit als schlimm, andere nicht. Und wieder andere verdrängen vielleicht. Fakt ist: Die Krippenerziehung in der DDR wirkt nach. Wer Eltern hat, die in der DDR in eine Krippe gingen, oder wer selbst in der DDR in eine Krippe ging, gibt sein Kind tendenziell eher selbst in eine Krippe als Menschen, deren Eltern das anders machten.
Und das gilt genau andersherum für die westdeutsche Bundesrepublik, mit deren Glaubenssätzen sich Nora Imlau im folgenden Abschnitt befasst. Dabei macht sie deutlich, dass seit der Adenauerzeit die heteronormative Kleinfamilie das Idealbild war: Vati verdient das Geld, Mutti kümmert sich um Familie und Haushalt. Das zeigte sich auch in der Gesetzgebung, zum Beispiel im Ehegattensplitting, dem (mittlerweile abgeschafften) „Schuldprinzip“ bei Scheidungen oder der nötigen Zustimmung des Ehemanns, wenn eine verheiratete Frau* arbeiten wollte.

Obwohl für manche der rechtlichen Voraussetzungen zum Glück Änderungen erstritten werden konnten, sind Mütter* in Westdeutschland heute oft dennoch zerrissen, denn einerseits wurde ihnen gesellschaftlich eingetrichtert (und im Umfeld vorgelebt), ganz für die Kinder da zu sein, andererseits sollen sie beruflich aktiv bleiben – was für viele auch eine finanzielle Notwendigkeit ist. Dabei wird oft übersehen, dass den Müttern* diese Aufteilung, immer nur für das Kind da zu sein, genauso wenig gut tut wie wenn sie ihr Kind nur schlafend sehen.
Mütter* wurden und werden also je nach politischem System instrumentalisiert – ob es ihnen aber damit gut geht, wird kaum gefragt.
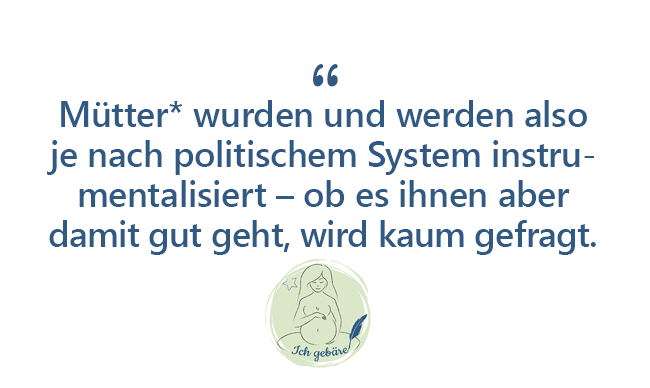
Beide Systeme argumentieren dementsprechend auch viel häufiger mit dem Wohle des Kindes als mit dem Wohle der Mutter* (und eigentlich auch der Eltern, nicht nur der Mütter*!).
Mütter* sind, egal wie sie es machen, Rabenmütter. (Kurzer Einschub: Dass das sexistisch ist, siehst du schon daran, dass es den Begriff „Rabenvater“ nicht gibt.) Und das ist schädlich, wie die Autorin ausführt:
Dabei hängt die Qualität von Mutterschaft überhaupt nicht davon ab, ob eine Frau gerne mit ihrem Kind zu Hause bleibt oder lieber früh wieder arbeiten gehen will.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 150
Denn es kommt nicht nur auf die Mutter* an, sondern auf das gesamte Umfeld, das die Kinder geborgen und sicher gebunden aufwachsen lässt.
Es gibt nach wie vor viel zu tun, um die alten Bilder aus den Köpfen zu bringen – Eltern müssen, so die Autorin, zum Beispiel aufhören, die Betreuungskosten vom Gehalt der Mutter* abzuziehen (sondern stattdessen von beiden Gehältern).
(Zu diesem Thema empfehle ich euch das Buch Love and Money* von Marielle und Mike Schäfer. Sie gehen im Buch auf die verschiedenen Phasen von Beziehung ein und wie sich unser finanzielles Zusammenleben im laufe der Zeit ändert. Es geht also im Buch nicht nur um die Frage nach der Aufteilung zwischen Care- und Berufsarbeit, sondern zum Beispiel auch um gemeinsames Wohnen, um Altersvorsorge und Testamente. Es geht aber eben auch darum, wie sich verschiedene Elternzeit- und Elterngeld-Modelle auswirken auf die kurzfristige und die langfristige finanzielle Perspektive der Familie. Einen kostenlosen Elterngeld-Check gibt es übrigens hier: kostenloser Elternzeit-Plan.)
No products found.
Und Eltern müssen den Begriff der „Fremdbetreuung“ sehr genau unter die Lupe nehmen. Das nimmt Nora Imlau im nächsten Abschnitt an.
„Fremdbetreuung“
Dabei ist eine Klarstellung zu Beginn ganz wichtig – die sich übrigens auch auf die Rabenväter von vorhin anwenden lässt:
Viele Begrifflichkeiten, mit denen wir noch heute über familienpolitische Maßnahmen wie individuelle Lebensentscheidungen sprechen, entstammen einer Sprache, die aus dem erbitterten ideologischen Kampf zweier verfeindeter politischer Systeme entstanden ist – wobei sich die Sprache des Westens durchgesetzt hat.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 152
Ich persönlich lebe in Brandenburg und möchte den letzten Teil dieser Aussage für mein persönliches Umfeld etwas relativieren (ich lerne hier durchaus auch neue Vokabeln, die ich aus NRW nicht kannte), kann ihm allerdings in Bezug auf gesellschaftliche Debatten durchaus zustimmen.
Wenn wir also von Fremdbetreuung sprechen, lasst uns im Hinterkopf haben, dass dieser Begriff in der westdeutschen Bundesrepublik entstand, als das gewünschte Familienmodell aus einem erwerbstätigen Vater und einer sorgearbeitenden Mutter* bestand. Höchstens noch Omas oder andere („selbstverständlich“) weibliche Familienmitglieder sollten auf den Nachwuchs aufpassen. Alle anderen Menschen waren fremd – und würden ein Kind also „fremdbetreuen“.
Nora Imlau zeigt, dass das Wort „fremd“ im Zusammenhang mit der Betreuung von Kleinkindern heutzutage unangemessen ist, denn die Kinder sind nicht von fremden Personen umgeben, sondern von Personal, das sie kennen und dem sie vertrauen. Dieses Verständnis war nicht immer so, aber die Autorin macht deutlich, dass alle Reformen in Bezug auf die außerfamiliäre Betreuung von Kleinkindern in den letzten 40 Jahren darauf ausgerichtet waren, sichere Bindungen zwischen Kind und Personal zu vereinfachen.

Statt „Fremdbetreuung“ schlägt sie deshalb folgende Begriffe vor: bindungsorientierte Kleinkindbetreuung, familienergänzende Betreuung, frühkindliche Betreuung.
Doch auch wenn sich diese Begriffe mancherorts langsam durchsetzen, müssen sich Frauen* häufig rechtfertigen (und zwar wesentlich mehr als Männer), wenn ihre kleinen Kinder außerfamiliär betreut werden. Die Autorin schreibt sogar, wir würden in einem „Land der Bewertungen“ (Seite 155) leben. Eine Frau* wird für ihre Entscheidungen bewertet – nur Kinder, nur Karriere, Kinder und Karriere, keine Kinder und kein Karriere? Egal. Irgendjemand wird die Entscheidung immer bewerten. Und auch die Frauen* selber bewerten ihre eigenen Entscheidungen und die Entscheidungen anderer Frauen*. Und natürlich ist dabei auch ausschlaggebend, wie wir sozialisiert wurden. Doch kaum jemand kann sich selbst davon frei machen, andere Lebensentwürfe nicht zu bewerten.
Kurzer Exkurs: Betreuung im Grundschulalter je nach Bundesland
Ich möchte an dieser Stelle noch ein anderes Thema aufgreifen, das in der Rezension so nicht vorkommt, was aber im Alltag durchaus relevant ist: Die Debatte um Kinderbetreuung ist oft sehr stark auf das Kleinkind- und Vorschulalter fokussiert. Dabei zeigt sich die Herausforderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade auch im Grundschulalter besonders deutlich. Während Kitas meist Ganztagsbetreuung anbieten, sieht die Situation an Grundschulen je nach Bundesland sehr unterschiedlich aus. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule wird erst ab 2026 schrittweise eingeführt. Bis dahin müssen viele Familien kreative Lösungen finden. Diese Situation führt oft dazu, dass der berufliche Wiedereinstieg nach der Kleinkindphase erneut auf den Prüfstand gestellt werden muss – eine Herausforderung, die wieder einmal überwiegend die Mütter* betrifft.
Familieninterne Unterschiede: Deine Meinung
Klar, die Buchrezension ist noch nicht am Ende. Aber ich bin trotzdem gespannt auf deine Erfahrungen: Wurdest du für deine Entscheidung schon mal kritisiert (und womöglich sogar in unterschiedliche Richtungen)? Inwieweit hast du dich bisher damit auseinander gesetzt, dass Betreuungssysteme immer auch einer politischen Agenda folgen? Wie sehr prägt dich die Betreuungsform deiner eigenen Kindheit bei deinen heutigen Entscheidungen oder Ansichten? Hast du schon einmal erlebt, dass du selbst andere Betreuungsmodelle bewertet hast, und was hat das mit dir gemacht? Inwieweit unterscheiden sich die Ansichten zu Kinderbetreuung in deiner Familie – etwa zwischen den Generationen oder zwischen Ost und West? Und welche Rolle spielt das Thema finanzielle Absicherung bei deinen Überlegungen zur Kinderbetreuung?
Ich freue mich auf deine Meinung!
Weiter mit dem nächsten Kapitel geht es dann im nächsten Blogpost.
Wöchtenliche Updates zu neuen Beiträgen
Katharina Tolle
Wie schön, dass du hier bist! Ich bin Katharina und betreibe seit Januar 2018 diesen Blog zu den Themen Geburtskultur, selbstbestimmte Geburten, Geburtsvorbereitung und Feminismus.
Meine Leidenschaft ist das Aufschreiben von Geburtsgeschichten, denn ich bin davon überzeugt, dass jede Geschichte wertvoll ist. Ich helfe Familien dabei, ihre Geschichten zu verewigen.
Außerdem setze ich mich für eine selbstbestimmte und frauen*-zentrierte Geburtskultur ein. Wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, schreib mir gern!