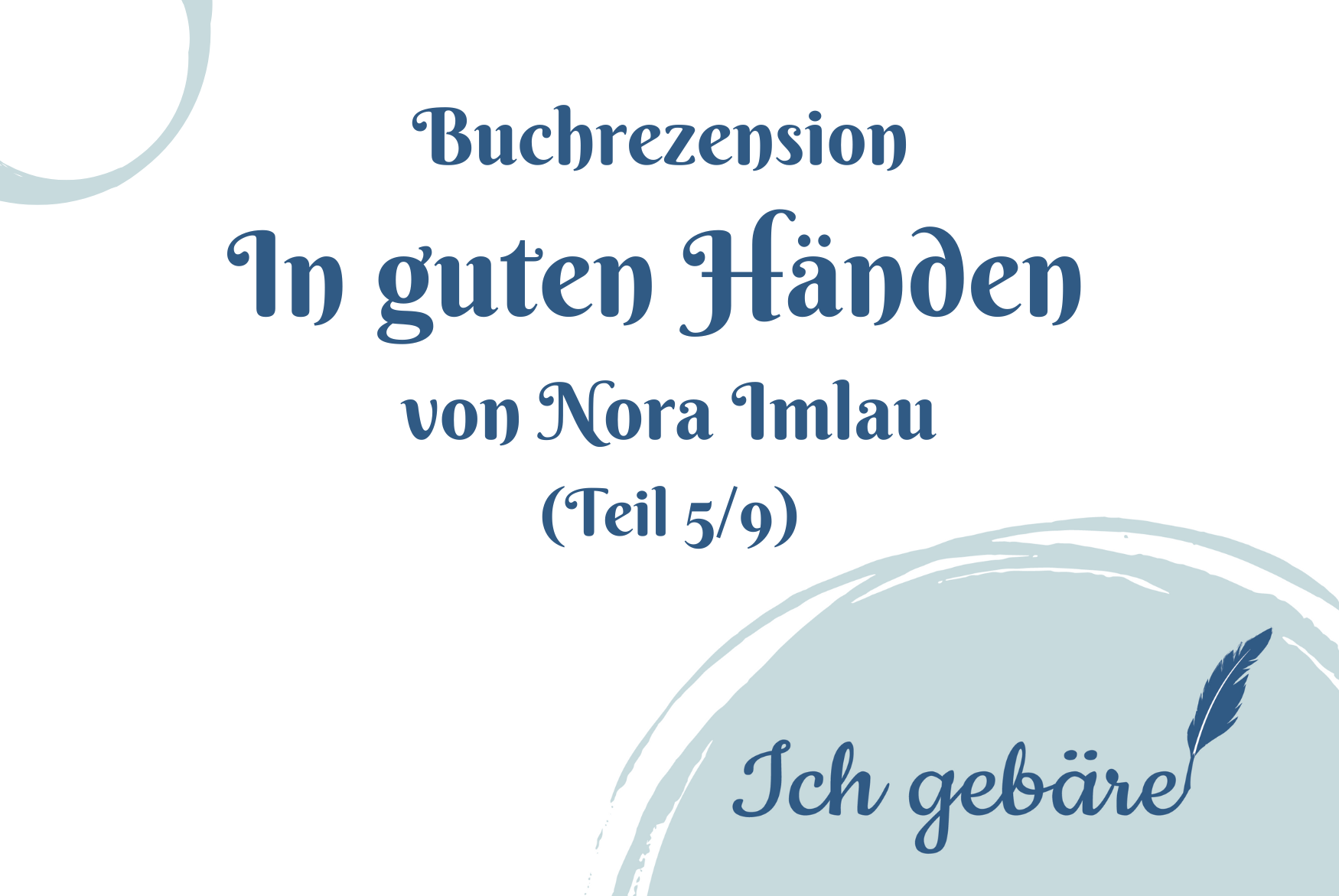Halbzeit: Heute veröffentliche ich den mittleren Teil meiner Buchrezension von Nora Imlaus In guten Händen. Vier habe ich schon veröffentlicht (siehe unten), vier werden noch folgen.
Als Service für dich verlinke ich in meinen Beiträgen Produkte oder Dienstleistungen. Manchmal sind das Affiliate-Links. Ich erhalte also eine Provision, ohne dass du mehr zahlst. Affiliate-Links sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
Um denjenigen gerecht zu werden, die sich mit den Worten „Frau“ oder „Mutter“ nicht identifizieren können, obwohl in ihrer Geburtsurkunde „weiblich“ steht, habe ich mich dazu entschlossen, in meinen eigenen Beiträgen „Mutter“ und „Frau“ jeweils mit dem Inklusionssternchen zu versehen. Ihr werdet also Frau* oder Mutter* lesen (falls der Text von mir kommt und nicht von anderen Menschen). Geschlechtergerechte und inklusive Sprache ist mir ein Herzensthema, allerdings ist (meine persönliche und die gesellschaftliche) Entwicklung dazu noch lange nicht abgeschlossen. Mal sehen, wie ich es in Zukunft angehe. Mehr zum Thema liest du unter anderem hier: Sollte ein Geburtsblog geschlechtsneutral sein, Gebären wie eine Feministin und Sex, Gender, Geburten und die deutsche Sprache.
Alle Rezensionsteile
Wenn du die blaue Box ausklappst, müsstest du die Links zu allen bisher erschienenen Teilen der Rezension finden.
In guten Händen: Alle Teile der Rezension
(bitte zum Lesen aufklappen)

- Teil: (hier lesen)
- Überblick
- Einleitung
- Kapitel 1: Ein Dorf für uns und unser Kind
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 2: Auf die Bindung kommt es an
- Kapitel 3: Familie und Freundeskreis (Einleitung, Bezugspersonen von Babys)
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 3: Familie und Freundeskreis (Fortsetzung bis Kapitelende)
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 4: Was prägt uns in der Betreuungsfrage? Eine Spurensuche
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 5: Unseren Weg als Familie finden
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 6: Ein guter Ort für unser Kind
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 7: Es geht los
- Teil:
- Kapitel 8: Neue Beziehungen: Schule und Kinderfreundschaften
- Teil:
- Der Schluss: Ein Netz, das trägt
- Meine Meinung: In guten Händen
- Fazit
Kapitel 5: Unseren Weg als Familie finden
Wenn es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Sorgearbeit und Betreuung zu organisieren, ist das toll, weil sich die Chancen erhöhen, etwas individuell Passendes zu finden. Doch es bedeutet auch Aufwand, denn man muss sich mit den verschiedenen Modellen und Möglichkeiten auseinander setzen – und merkt vielleicht, dass das optimale Modell aus bestimmten Gründen gerade nicht umsetzbar ist.
Genau auf dieses Thema geht Nora Imlau im fünften Kapitel ein.

Dabei macht sie deutlich: Studien und wissenschaftliche Erhebungen sind nützlich, können aber nicht voraussagen, ob genau unser Kind mit unserer Entscheidung gut zurechtkommen wird.
Und natürlich können wir nicht immer rein so entscheiden, wie wir gerne möchten, weil wir den lokalen Rahmenbeindungen unterworfen sind: So spielt auch die fiannzielle Situation eine Rolle bei der Frage, ob Kinder außerfamiliär betreut werden.
Spannend fand ich die Aussage, dass die außerfamiliäre Betruung kleiner Kinder auch eine klassistische Färbung habe:
Letztlich wird damit die soziale Schicht abgewertet, die eben nicht die Wahl hat, jahrelang von einem Einkommen zu leben.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 160
Anders ausgedrückt: Wer nicht genug Geld hat, muss arbeiten gehen, da ist die Wahl gar nicht gegeben. Und das ist höchst problematisch – erst recht, wenn man davon ausgeht, dass die familiäre Betruung doch eigentlich besser wäre und für sozial benachteiligte Familien aber nun mal nicht zur Verfügung steht. Diese Situation wäre durchaus ein eigenes Buch wert.
Da aber nun mal viele Familien ihre Kinder früher oder später außerfamiliär betreuen lassen, konzentriert sich die Autorin im Rest des Kapitels auf diese außerfamiliäre Betreuung. Sie zeigt, dass es für die meisten Eltern gar nicht so einfach ist, zu entscheiden, welche Krippe für ihr Kind die beste ist. Dabei hat sie ein wenig die Stadtbrille auf, denn auf dem Land ist diese Frage oft eher rhetorischer Natur, weil die logistische Machbarkeit kaum Optionen zulässt – wobei auch hier reiche Menschen noch eher Möglichkeiten finden, durch bezahlte Hilfe eine gute Lösung zu finden oder eben doch noch länger zu warten, bis der „richtige“ Kitaplatz für das eigene Kind verfügbar ist.

So geht es, wie die Autorin schreibt, nicht um die „objektiv beste Entscheidung der Welt“, sondern um „eine, mit der unsere Kinder und wir im Rahmen unserer Lebenssituation und unserer Möglichkeiten gut leben können“ (Seite 162). Hier finde ich übrigens extrem wichtig, zu betonen: Nicht nur das Kind, auch die Eltern müssen mit der Entscheidung gut leben können! Eine Wahlkita, die wegen eines gewissen Aspektes bevorzugt wurde, dafür aber einen viel komplizierteren Anfahrtsweg hat, wird nämlich vermutlich auf Dauer vielleicht das Kind nicht stören, die Eltern aber unter Umständen doch sehr einschränken.
Die Qual der Wahl
Der nächste Abschnitt des Kapitels ist provokant mit „Was für ein Leben soll‘s denn sein?“ überschrieben. Und genau darum geht es, denn Eltern und Kinder haben individuelle Bedürfnisse, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Und nicht alle Mütter* und nicht alle Väter* haben dieselben Wünsche. So fragt Nora Imlau dann auch:
„Wie viel gemeinsam mit meinem Kind verbrachte Zeit brauche ich, damit es mir gut geht? Was ist mir zu viel, was zu wenig davon? Wie viel Zeit würde ich in einer idealen Welt ganz für mich alleine haben? Wie viel Zeit davon würde ich mit Erwerbstätigkeit verbringen – und in welcher?“
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 164
Und ja, diese Fragen richten ich an die Eltern!
Die Liste der Fragen geht noch weiter, und kann helfen, zu merken, was wirklich wichtig ist. Sie kann auch hilfreich sein, Stressoren im Alltag zu identifizieren, zum Beispiel Zeit ohne die Kids (der Klassiker ist wohl, dass gerade Mütter* sich rechtfertigen müssen, wenn sie mal einen Abend ohne ihre Kinder verbringen wollen).
Wenn es dann also darum geht, dass das Kind außerfamiliär betreut werden soll, sind wir in unserer konkreten Entscheidung vielleicht nicht so frei, wie es theoretisch scheint. Doch selbst wenn wir bei der Auswahl der Einrichtung und des Zeitpunktes gefühlt keine Wahl haben, haben wir doch in einem Punkt immer eine Wahl, so die Autorin: Wir können immer entscheiden, wie wir den Start in diese neue Situation vorbereiten und begleiten.
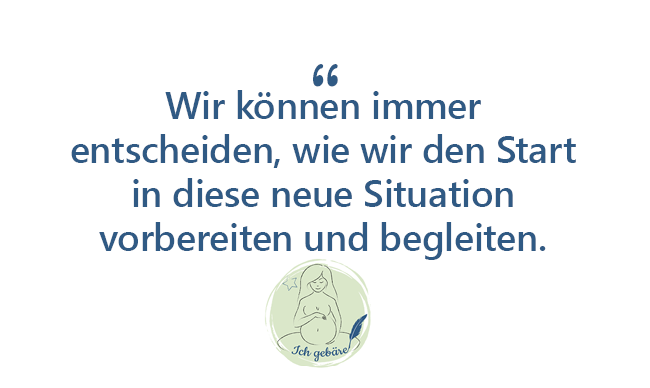
idealtypische Bedürfnisse
Dabei gilt grundsätzlich: Wenn ein Kind in der Familie bis dahin die Erfahrung einer sicheren Bindung gemacht hat, fällt es ihm leichter, diese Bindung auch in der neuen Betreuungssituation entstehen zu lassen. In diesem Fall ist selbst eine mittelmäßige Betreuung für die meisten Kinder kein Problem, so Nora Imlau:
Denn sie [die Kinder] haben verinnerlicht, sich an jedem Ort nur das mitzunehmen, was ihnen guttut – und sich den Rest zu Hause zu holen.“
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 167
Besonders wichtig finde ich in diesem Zusammenhang ihren Einwurf, dass das, was wir uns idealtypisch für unsere Kinder wünschen, nicht unbedingt zwingend nötig sein muss, damit das Kind ein gutes Leben hat.
Das gilt umso mehr, weil unsere idealtypische Vorstellung vielleicht für uns persönlich ideal wäre – aber nicht unbedingt für ihr Kind. Auf das Zusammenkommen dieser verschiedenen Bedürfnisse geht die Autorin im nächsten Abschnitt ein.
Sie erzählt von ihren eigenen Erfahrungen, die zeigen: Keine zwei Einjährigen sind gleich, und deshalb ist es auch müßig, aufgrund von Statistiken (also Durchschnittswerten) wissen zu wollen, welche Betreuungsform genau für dieses einzelne Kind richtig ist.
Manifest für eine selbstbestimmte Geburtskultur

Sie macht deutlich, dass wir bei der Eingewöhnung in eine Betreuungssituation Schmerz zulassen dürften, und betont, dass es an uns Eltern liege, diesen Schmerz zu begleiten. Und wir dürfen genauso darauf achten, was wir als Eltern eigentlich brauchen, um diese Phase gut zu durchstehen. Denn wir können nur Liebe und Empathie geben (und unserem Kind damit sichere Bindung in unsicheren Zeiten geben), wenn wir selbst in uns ruhen. Denn:
In einer Bindungsbeziehung wie der zwischen Eltern und Kind hängt das Wohlergehen unserer Kinder von unserem eigenen mindestens ebenso ab wie umgekehrt.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 172
Das Geben von Liebe und Empathie geht übrigens auch, wenn wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, solange wir uns nicht dauerhaft verbiegen müssen. Das gelingt am besten, wenn die Bedürfnisse des Kindes, die wir selber nicht gut erfüllen können, durch andere Personen gut gedeckt werden können – das kann durchaus auch in der außerfamiliären Betreuung passieren.
Babysitter*innen, Nannys, Au-Pairs
Wenn ich von „außerfamiliärer Betreuung“ schreibe, denkst du vermutlich als erstes an Krippen und Kindergärten. Doch es gibt auch andere Optionen, wie zum Beispiel Babysitter*innen, Nannys und Au-Pairs. Auf diese außerfamiliäre Betreuung, die meist dennoch in und um die Wohnung stattfindet, geht Nora Imlau im nächsten Abshcnitt ein. Dabei ist der wichtigste Satz aus meiner Sicht: Bindung braucht Zeit. Babsitter*innen helfen bei kleinen Kindern kaum, wenn sie nur einmal alle acht Wochen kommen. Wenn sie regelmäßig kommen (auch, wenn die Eltern da sind), helfen sie dagegen viel besser. Das gilt umso mehr, wenn wir Eltern den Bindungsaufbau (ähnlich wie in einer Kita) begleiten – auch, wenn das erstmal finanziellen und zeitlichen Aufwand bedeutet.
Ein No-Go ist auf jeden Fall eine „heimliche Babysittersituation“ – wenn die Eltern die Kinder ins Bett bringen und jemand dann kommt, während das Kind schläft. Das stellt einen großen Vertrauensbruch dar.
In Bezug auf Au-Pairs gibt Nora Imlau zu bedenken, dass viele junge Menschen diese Rolle anstreben, während sie eigentlich „emotional selbst noch halbe Kinder“ (Seite 177) seien und entsprechend überfordert mit einem Kind, das eigentlich emotionale Unterstützung braucht. Vollkommen neu war für mich das Konzept der Granny-Au-Pairs: Hierbei handelt es sich auch um Menschen aus dem Ausland, die aber bereits im Großelternalter sind.

Zu Hause bleiben zur Kinderbetreuung
Im nächsten Abschnitt geht die Autorin ausführlich darauf ein, was es bedeutet, als Elternteil (statistisch gesehen: als Mutter*) im Kleinkindalter mehrere Jahre zu Hause zu bleiben. Das kann, wie die Autorin schreibt, eine gute Entscheidung sein, die viel Druck aus dem Familienleben nimmt. Es kann aber auch der Weg in die Altersarmut (gerade für Frauen*) sein und es kann dazu führen, dass die Bedürfnisse der sorgearbeitleistenden Person häufig unter den Tisch fallen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass die größtenteils bis ausschließlich familiäre Betreuung von Kindern leider auch politisch missbraucht wird – und zwar noch extremer als in der alten westdeutschen Bundesrepublik, nämlich von der extremen Rechten. Diese machen mit ihrem Bild, dass nur biologische Eltern Kinder angemessen betreuen könnten, Politik gegen staatliche Institutionen und angebliche Überfremdung. Es geht hier keinesfalls darum, allen Menschen, die ihre Kinder zu Hause selbst betreuen, ein rechtsextremes Weltbild zu unterstellen – das wäre schlecht Blödsinn. Die Autorin möchte vielmehr darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, darauf zu achten, von wem man für seine Lebensentscheidungen Applaus annimmt. (Darauf geht Nora Imlau übrigens auch in einem Blogartikel ein, über den du hier mehr erfährst: Falsche Freunde)
Problematisch findet die Autorin (und ich stimme ihr da voll zu), dass die Betreuung von Kindern zu Hause meist traditionelle Geschlechterrollen zementiert, ohne dass dies reflektiert wird. Denn rein theoretisch könnten auch Väter die ersten Jahre zu Hause bleiben und Mütter* Alleinverdienerinnen sein. Diese Konstellation ist allerdings immer noch stark unterrepräsentiert in Deutschland.
Die Autorin schließt diesen Abschnitt ab mit einem Fazit, das ich voll unterstütze: Ob Familien ihre Kinder außerfamiliär betreuen lassen wollen oder nicht, ist ihre Entscheidung. Und sie ist legitim. Gute Familienpolitik unterstützt, dass die Bedürfnisse von Familien in ihrer Mannigfaltigkeit gesehen und unterstützt werden. Gute Kita-Betreuung ist davon ein wichtiger, aber nicht der einzige Aspekt.
Exkurs: Familienpolitische Entscheidungen
(bitte zum Lesen aufklappen)
Es gibt eine Vielzahl an politischen Rahmenbedingungen, die unser Familienleben beeinflusst. Das fängt schon mit der Frage nach der Bezahlung von Kinderwunschbehandlungen und der Auswahl von Adoptionsplätzen an, geht über die Geburtshilfe (es gibt Staaten, in denen Hausgeburten verboten sind) und die Wochenbettbetreuung über die Regulierung von Mutterschutzzeiten (zum Beispiel auch für Eltern von Sternenkindern), Elterngeld, Elternzeit, Kindergeld, bezahlter Freistellung für nicht-gebärende Elternteile… Und da sind wir noch nicht mal bei der Betreuung nach der Elternzeit und der damit verbundenen Wertschätzung von Sorgearbeit angekommen. Es geht dann weiter mit der Gestaltung der Schulzeit, zu der es ebenfalls ganze eigene Blogs gibt.
Planänderungen
Nachdem es bisher darum ging, die individuell beste Lösung zu finden, widmet sich die Autorin im letzten Kapitel der Frage, wie wir damit umgehen, wenn Pläne nicht aufgehen.
Es ist etwas völlig anderes, sich theoretisch darüber auszutauschen, wann der beste Betreuungsstart ist, als im Alltag mit einem kleinen Kind allmählich ein Gefühl dafür zu entwickeln, was zu ihm und zu uns wirklich passt.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 187
Und das müssen wir übrigens mit jedem weiteren Kind wieder neu erleben. Deshalb bedeutet es auch kein Scheitern, einmal getroffene Pläne wieder umzuschmeißen.
Denn letztendlich kann, so die Autorin, (fast) jede Lösung eine gute sein – nur nicht zu jeder Zeit und für jede Familie. Wir müssen Kompromisse schließen, und auch unsere Kinder lernen das. Und deshalb ist jenseits aller Grundsatzdiskussionen und idealtypischen Pläne vor allem eines wichtig:
Niemand muss stets höchsten pädagogischen Idealen genügen, um für Kinder ein grundsätzlich sicherer Hafen zu sein.
Weiter mit dem 6. Teil der Buchrezension geht es dann im nächsten Blogpost.
Wöchtenliche Updates zu neuen Beiträgen
Katharina Tolle
Wie schön, dass du hier bist! Ich bin Katharina und betreibe seit Januar 2018 diesen Blog zu den Themen Geburtskultur, selbstbestimmte Geburten, Geburtsvorbereitung und Feminismus.
Meine Leidenschaft ist das Aufschreiben von Geburtsgeschichten, denn ich bin davon überzeugt, dass jede Geschichte wertvoll ist. Ich helfe Familien dabei, ihre Geschichten zu verewigen.
Außerdem setze ich mich für eine selbstbestimmte und frauen*-zentrierte Geburtskultur ein. Wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, schreib mir gern!