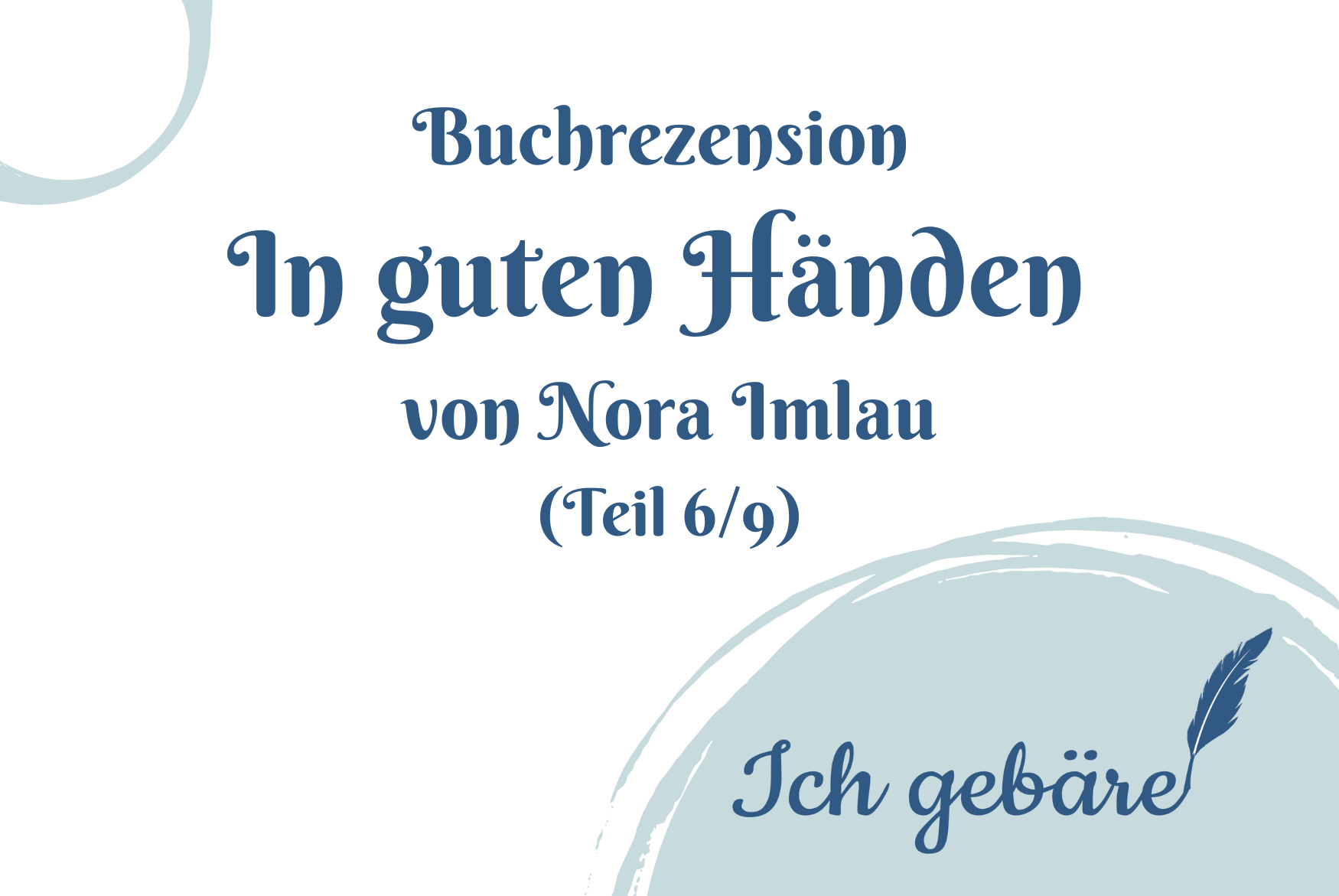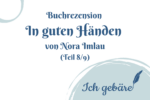Heute veröffentliche ich Teil 6 der Buchrezension in guten Händen. Alle anderen Rezensionsteile findest du unten verlinkt.
Als Service für dich verlinke ich in meinen Beiträgen Produkte oder Dienstleistungen. Manchmal sind das Affiliate-Links. Ich erhalte also eine Provision, ohne dass du mehr zahlst. Affiliate-Links sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
Um denjenigen gerecht zu werden, die sich mit den Worten „Frau“ oder „Mutter“ nicht identifizieren können, obwohl in ihrer Geburtsurkunde „weiblich“ steht, habe ich mich dazu entschlossen, in meinen eigenen Beiträgen „Mutter“ und „Frau“ jeweils mit dem Inklusionssternchen zu versehen. Ihr werdet also Frau* oder Mutter* lesen (falls der Text von mir kommt und nicht von anderen Menschen). Geschlechtergerechte und inklusive Sprache ist mir ein Herzensthema, allerdings ist (meine persönliche und die gesellschaftliche) Entwicklung dazu noch lange nicht abgeschlossen. Mal sehen, wie ich es in Zukunft angehe. Mehr zum Thema liest du unter anderem hier: Sollte ein Geburtsblog geschlechtsneutral sein, Gebären wie eine Feministin und Sex, Gender, Geburten und die deutsche Sprache.
In guten Händen: Ein Überblick
In guten Händen: Alle Teile der Rezension
(bitte zum Lesen aufklappen)

- Teil: (hier lesen)
- Überblick
- Einleitung
- Kapitel 1: Ein Dorf für uns und unser Kind
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 2: Auf die Bindung kommt es an
- Kapitel 3: Familie und Freundeskreis (Einleitung, Bezugspersonen von Babys)
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 3: Familie und Freundeskreis (Fortsetzung bis Kapitelende)
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 4: Was prägt uns in der Betreuungsfrage? Eine Spurensuche
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 5: Unseren Weg als Familie finden
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 6: Ein guter Ort für unser Kind
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 7: Es geht los
- Teil:
- Kapitel 8: Neue Beziehungen: Schule und Kinderfreundschaften
- Teil:
- Der Schluss: Ein Netz, das trägt
- Meine Meinung: In guten Händen
- Fazit
Kapitel 6: Ein guter Ort für unser Kind
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die außerfamiliäre Betreuung und die Frage, wie wir für unser Kind die richtige Krippe, die richtigen Tageseltern oder prinzipiell die richtige Betreuungsform finden.
Das folgende Zitat könnte an jeder Stelle in dieser Buchrezension stehen, aber da es zu Beginn dieses Kapitels steht, füge ich es auch hier ein:
Ein Kind in seiner ganzen Schutzlosigkeit und Bedürftigkeit Wildfremden zu überlassen, ist für uns alle zu Recht ein Furcht einflößender und widerwärtiger Gedanke. Doch genau das passiert in einem starken Bindungsnetz nicht. Stattdessen trauen wir vertrauenswürdigen Menschen zu, verlässlich Verantwortung zu übernehmen, und tragen Sorge dafür, dass dies in einem Rahmen geschieht, der weder uns selbst noch unser Kind überfordert.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 193
Solange diese Grundvoraussetzung gegeben ist, können wir mit gutem Gewissen auch bezahlte Kinderbetreuung annehmen, denn die Frage, ob Geld fließt, hat nichts mit der Bindungssituation zu tun.
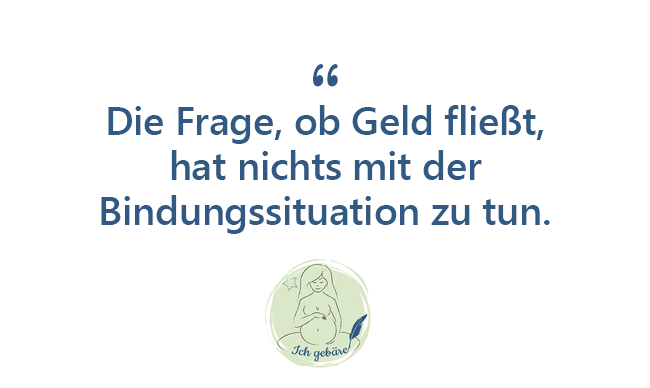
Problematisch ist es natürlich, wenn die institutionelle Kinderbetreuung finanziell (und dadurch auch personell) so schlecht ausgestattet ist, dass die Betreuungssituation darunter leidet. Laut OECD soll im Kleinkindalter ein Betreuungsschlüssel von 1:3, maximal 1:4 eingehalten werden – was in Deutschland regelmäßig nicht der Fall ist. Eine Gruppe soll aus maximal 12 Kindern bestehen. Der Betreuungsschlüssel ist ein Merkmal der Strukturqualität der Kita. Die Autorin führt aus, dass es zusätzlich zur Strukturqualität die Prozessqualität gibt, die zeigt, wie die unmittelbaren Interaktionen im Betreuungsalltag gestaltet werden. Natürlich sind Strukturmerkmale einfacher zu quantifizieren, aber für das Erleben des Kindes sind sie nun mal nicht alles.
Aus meiner Sicht ist es nicht überraschend, dass Bindungsforscher*innen in ihren Studien immer wieder sehr durchwachsene Ergebnisse liefern – laut der von Nora Imlau zitierten Bindungsforscherin Fabienne Becker-Stoll „von hervorragend bis grottenschlecht“ (Seite 196).
Manifest für eine selbstbestimmte Geburtskultur

Dabei gibt es nicht nur Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen, sondern häufig gar zwischen den einzelnen Gruppen. Aus meiner Sicht ist das kaum verwunderlich, denn letztendlich steht und fällt alles (wenn wir von einer finanziellen Abdeckung der Mindestanforderungen ausgehen) mit dem Personal. Und Erzieher*innen sind nun mal menschlich.
Nora Imlau plädiert dafür, bei der Auswahl der Kita besonders in denjenigen Aspekten großzügig zu sein, bei denen keine bindungsrelevanten Bereiche betroffen sind:
Dann gibt es eben kein Bio-Essen, kein Kinder-Englisch, mehr Plastik- als Holzspielzeug – so what? Davon hängt nicht ab, ob es unserem Kind gut gehen wird.“ Seite 197
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 197
(Und, als persönliche Ergänzung von mir: Bio-Essen, Englisch und Holzspielzeug können wir ja dann zu Hause umsetzen.)
Sobald es bindungsrelevant wird, sollten wir dagegen genau hinschauen. Zugewandtheit und Freundlichkeit sind in der frühkindlichen Bindung nun mal essentiell.
Die Autorin geht darauf ein, dass die Strukturen fester sein sollten, je jünger das Kind ist. Auch wenn das manchmal für Erwachsene rigide wirke, bräuchten kleine Kinder die Sicherheit vertrauter Abläufe, um sich wohlfühlen zu können.
Der Autorin ist durchaus bewusst, dass das Personal unter besseren Arbeitsbedingungen (kleinere Gruppen zählen da genauso dazu wie passende Arbeitszeiten) auch bessere Arbeit leisten kann. Deshalb dürften wir Kitas und das Personal dort finanziell nicht ausbluten lassen.

Wie können wir also wissen, ob eine Kitagruppe gute Bindungsarbeit leistet? Unser Kind kann uns das ganz gut vermitteln, so die Autorin:
Finden Kinder morgens gut den Übergang in die Kita und werden sie nachmittags gut gelaunt wieder abgeholt, dürfen wir davon ausgehen, dass es ihnen dort gut geht und sie sicher gebunden sind.
Als Eltern dürfen wir also einerseits einen Vertrauensvorschuss geben, andererseits ist es an uns, auch immer wieder hinzuschauen und zu merken, wie unser Kind in der Kita klar kommt. Dabei sollten wir im Kopf behalten: „Aus Kinderperspektive sind an einer Kita oft ganz andere Dinge schön als aus Erwachsenensicht“ (Seite 215).
Und falls wir merken, dass unser Kind nicht klar kommt, sind unsere Prioritäten klar: Dann lassen wir es nicht dort.
Eingewöhnung
In diesem Kapitel geht die Autorin auch auf die Eingewöhnung in eine neue Betreuungssituation ein und stellt fest, dass die meisten Kleinkinder zwei bis vier Wochen brauchen, bis sie sich in der neuen Umgebung wohlfühlen. Manche Kinder brauchen auch länger. Sie betont den Nutzen von Voreingewöhnungen, wenn also das Kind schon vor der eigentlichen Eingewöhnung schon ein paar mal in die Kita schnuppern kann. (Viele jüngere Geschwisterkinder haben diesen Effekt automatisch, wenn sie die Eltern beim Bringen oder Abholen der älteren Geschwister begleiten.)
In Bezug auf Tagespflege statt Kita macht die Autorin deutlich, dass hierfür keine Ausbildung, sondern nur eine recht kurze Weiterbildung nötig ist. Das Konzept der Tagespflege ist eine „zweite Familie“, bei der noch viel mehr als in der Kita die Qualität der Betreuung von den Tageseltern abhängt. Nora Imlau fasst zusammen, wie sie und ihr Mann damals an die Suche nach Tageseltern gegangen sind: Sie suchten für ihre Kinder nach einer Familie, in der sie gern selber bleiben würden.
Frühkindliche Bildung
Im nächsten Abschnitt des Kapitels fasst sie zusammen, was für die frühkindliche Bildung wirklich wichtig ist. Sie kritisiert dabei die Versuche, bereits aus den Kleinsten möglichst viel Potential auszuschöpfen durch Frühförderung und Kompetenzentwicklung im Sinne der Wirtschaft.
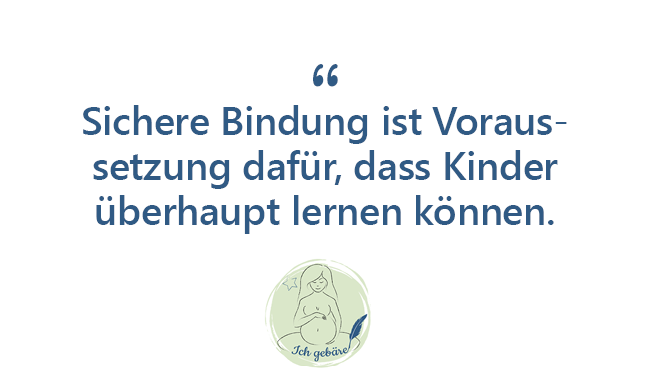
Viel mehr sei die sichere Bindung die Voraussetzung dafür, dass Kinder überhaupt lernen könnten. Es nutzt also nichts, einem Kind viel vorzulesen, wenn es nicht sicher gebunden ist. Der positive Effekt von Vorlesen, Mathespielen oder Kinderyoga komme erst zum Tragen, wenn die Grundbedürfnisse des Kindes nach Sicherheit und Bindung erfüllt sind.
Viel wichtiger als thematische Frühförderung sei die Ausbildung anderer Kompetenzen: Wer im Kindesalter nicht lernt, mit anderen Menschen klarzukommen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen oder sich in andere Menschen hineinzuversetzen, wird das im Erwachsenenalter wesentlich schwerer nachholen können als Mandarin oder Potenzrechnen.
Exkurs: Der internationale Vergleich
(bitte zum Lesen aufklappen)
Interessant ist in Bezug auf die Qualität von Kindertagesstätten auch der internationale Vergleich: In Deutschland stehen oft die kognitiven Aspekte frühkindlicher Bildung im Vordergrund, also zum Beispiel das Ausmalen ohne Übermalen, das Zeichnen von Kreisen, die Nutzung von Stift und Schere, das Erkennen von Bildern und so weiter.
Im Gegensatz dazu setzen skandinavische Länder stärker auf das sozial-emotionale Lernen und das freie Spiel.
Studien zeigen, dass dieser ganzheitliche Ansatz den Kindern nicht nur mehr Freude bereitet, sondern auch bessere Voraussetzungen für das spätere schulische Lernen schafft. Das freie Spiel ermöglicht es Kindern, ihre Umwelt selbstständig zu erkunden, Probleme eigenständig zu lösen und soziale Kompetenzen zu entwickeln – Fähigkeiten, die im späteren Leben mindestens genauso wichtig sind wie früh erworbenes Faktenwissen.
Falls du dich in dieser Richtung belesen willst, empfehle ich folgende Studien:
- OECD (2021). Starting Strong VI: Supporting Families and Children. OECD Publishing, Paris (Link zur Publikation)
- Melhuish, E., et al. (2015). A review of research on the effects of Early Childhood Education and Care (ECEC) upon child development. CARE project; Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood Education and Care (ECEC) (Link zur Publikation)
Montessori- und Waldorf-Einrichtungen
Der letzte Abschnitt dieses Kapitels widmet sich zwei besonderen Betreuungsformen, nämlich Montessori- und Waldorf-Einrichtungen. In Bezug auf Montessori-Einrichtungen stellt die Autorin fest, dass der Begriff nicht geschützt ist und es entsprechend kein verbindliches Qualitätskonzept gibt. Viele der Einrichtungen gehen, so die Autorin, von dem Grundsatz Maria Montessoris aus, dass Kinder sich individuell entwickeln, aber alle die Fähigkeit haben, sich selbst weiterzuentwickeln, wenn Erwachsene die Voraussetzungen dafür schaffen. Nora Imlau stellt fest, dass die Umsetzung dieses Grundsatzes manchen Kindern sehr hilft, während andere Kinder ein engeres Umfeld bevorzugen.
Ihr Fazit: Der Name Montessori entbindet uns als Eltern nicht davon, genau hinzusehen, wie das Konzept in der entsprechenden Einrichtung gelebt wird. Besonders bei kleinen Kindern darf das Konzept nicht dazu führen, dass Kinder alleingelassen werden (damit sie sich selbst entwickeln könnten), sondern „auch in ihrer Bedürftigkeit und Unselbstständigkeit angenommen werden“ (Seite 231).
Der Name Waldorf-Einrichtung ist im Gegensatz zu „Montessori-Kindergarten“ streng geschützt. Das Konzept basiert auf der Anthropologie:
Da anthroposophische Einrichtungen sich eben nicht nur als Kindergärten und Schulen, sondern auch als Seelenbildungsstätten sehen, hängt die Erfahrung, die Kinder und Jugendliche, aber auch ihre Eltern in Waldorfeinrichtungen machen, stark davon ab, welcher Charakter, welches Karma und welche seelische Entwicklungsstufe Pädago*innen vor Ort in einem Kind sehen. Genau das ist nämlich der explizite Auftrag der Waldorfpädagogik.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 234
Die freie Entfaltung des Individuums, so die Autorin, stehe hinter der „spirituellen Befreiung durch enge Führung und Lenkung“ (Seite 234) zurück.
Nora Imlau betont, dass es auch in Waldorfschulen warmherzige Pädagog*innen gibt, denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt. Der Name „Waldorf“ allein sei aber auch hier kein Garant dafür, dass unser Kind sicher gebunden und glücklich sein kann.
Übrigens: Einen ausführlichen Erfahrungsbericht zu einer Waldorf-Grundschule findest du auf Sophie Mikoschs Blog Mütterimpulse: Lavanda kommt auf die Waldorfschule. Hierin berichtet sie auch davon, dass der Name allein nicht ausschlaggebend für die Entscheidung war.
No products found.
Wöchtenliche Updates zu neuen Beiträgen
Katharina Tolle
Wie schön, dass du hier bist! Ich bin Katharina und betreibe seit Januar 2018 diesen Blog zu den Themen Geburtskultur, selbstbestimmte Geburten, Geburtsvorbereitung und Feminismus.
Meine Leidenschaft ist das Aufschreiben von Geburtsgeschichten, denn ich bin davon überzeugt, dass jede Geschichte wertvoll ist. Ich helfe Familien dabei, ihre Geschichten zu verewigen.
Außerdem setze ich mich für eine selbstbestimmte und frauen*-zentrierte Geburtskultur ein. Wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, schreib mir gern!