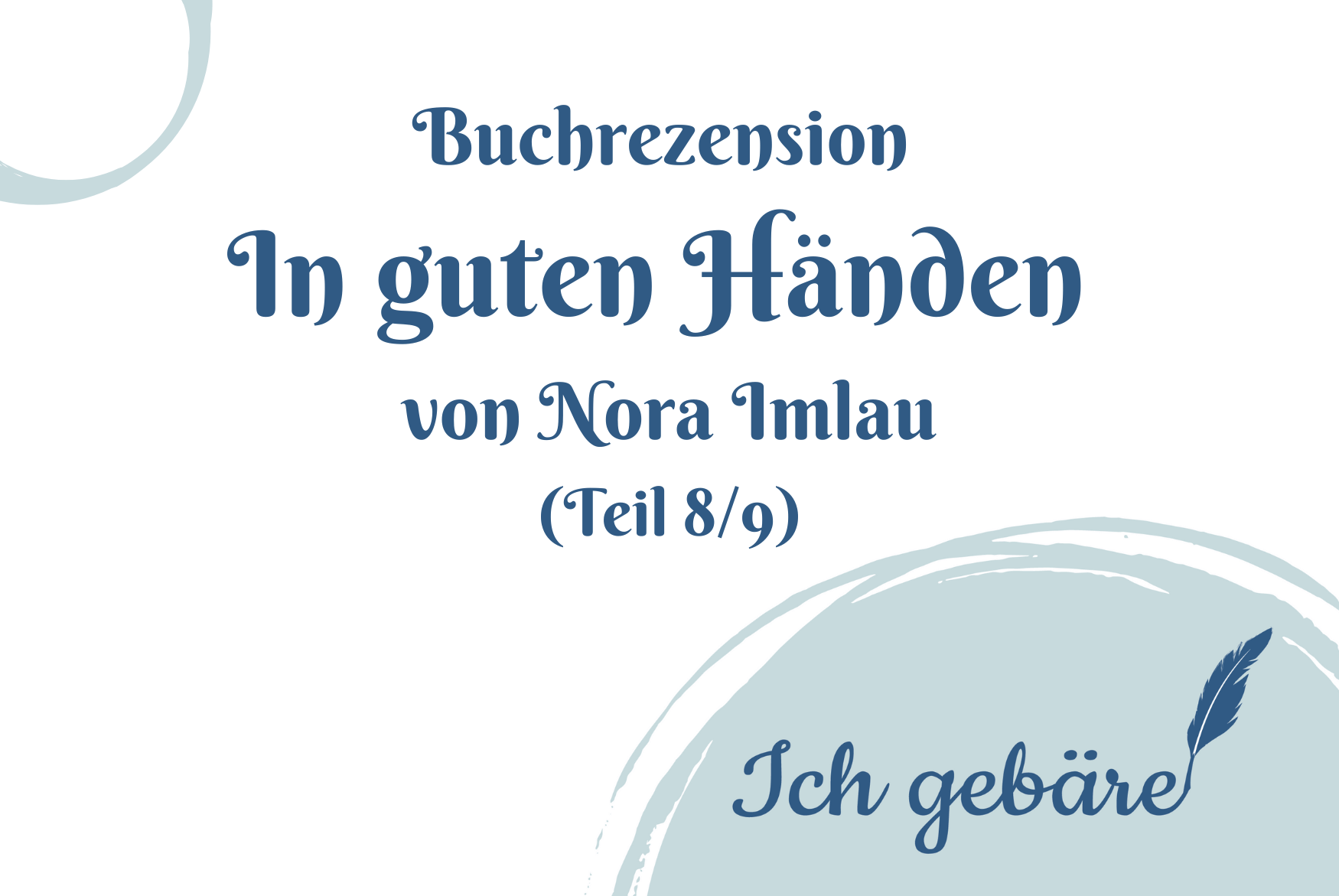Heute erscheint der achte und damit vorletzte Teil meiner Buchrezension zu Nora Imlaus Buch in guten Händen. Alle vorigen Teile findest du unten verlinkt.
Als Service für dich verlinke ich in meinen Beiträgen Produkte oder Dienstleistungen. Manchmal sind das Affiliate-Links. Ich erhalte also eine Provision, ohne dass du mehr zahlst. Affiliate-Links sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
Um denjenigen gerecht zu werden, die sich mit den Worten „Frau“ oder „Mutter“ nicht identifizieren können, obwohl in ihrer Geburtsurkunde „weiblich“ steht, habe ich mich dazu entschlossen, in meinen eigenen Beiträgen „Mutter“ und „Frau“ jeweils mit dem Inklusionssternchen zu versehen. Ihr werdet also Frau* oder Mutter* lesen (falls der Text von mir kommt und nicht von anderen Menschen). Geschlechtergerechte und inklusive Sprache ist mir ein Herzensthema, allerdings ist (meine persönliche und die gesellschaftliche) Entwicklung dazu noch lange nicht abgeschlossen. Mal sehen, wie ich es in Zukunft angehe. Mehr zum Thema liest du unter anderem hier: Sollte ein Geburtsblog geschlechtsneutral sein, Gebären wie eine Feministin und Sex, Gender, Geburten und die deutsche Sprache.
In guten Händen: Die vollständige Rezension
In guten Händen: Alle Teile der Rezension
(bitte zum Lesen aufklappen)

- Teil: (hier lesen)
- Überblick
- Einleitung
- Kapitel 1: Ein Dorf für uns und unser Kind
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 2: Auf die Bindung kommt es an
- Kapitel 3: Familie und Freundeskreis (Einleitung, Bezugspersonen von Babys)
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 3: Familie und Freundeskreis (Fortsetzung bis Kapitelende)
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 4: Was prägt uns in der Betreuungsfrage? Eine Spurensuche
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 5: Unseren Weg als Familie finden
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 6: Ein guter Ort für unser Kind
- Teil: (hier lesen)
- Kapitel 7: Es geht los
- Teil:
- Kapitel 8: Neue Beziehungen: Schule und Kinderfreundschaften
- Teil:
- Der Schluss: Ein Netz, das trägt
- Meine Meinung: In guten Händen
- Fazit
Kapitel 8: Neue Beziehungen: Schule und Kinderfreundschaften
Das letzte Kapitel im Buch widmet sich der Zeit der Schule. Schule ist ein wichtiger Einschnitt im Leben des Kindes – aber auch nur einer von mehreren, nicht der eine entscheidende Einschnitt. Auch in der Schule geht es um Bindungserfahrungen, nicht nur um Lernen. (Ich würde sogar sagen, in der ersten Klasse geht es mehr um Bindung als alles andere. Das wurde besonders deutlich, als unser Großer im ersten Schuljahr mehrere Monate Lockdown erlebte und wir zu Hause mit ihm lernen sollten.

Grundschulen sollen ein Ort der sozialen Durchmischung sein. Entsprechend sind die Grundschulbezirke zugeschnitten. (Das hat für Stadtmenschen vermutlich eine größere Relevanz als bei uns auf dem Dorf…)
Die Autorin bricht eine Lanze für die örtlichen Grundschulen, und zwar trotz des durchaus vorhandenen Reformbedarfs: Sie sieht vor allem die engagierten Lehrkräfte als Ressource, die unseren Kindern sichere Bindung und gute Lernerfahrungen ermöglichen.
Mein Highlight: „Letztlich macht nicht das Label eine Schule zu einer guten Schule, sondern die Menschen, die dort arbeiten, und die Beziehungen, die sie pflegen. (Seite 287 f.)“
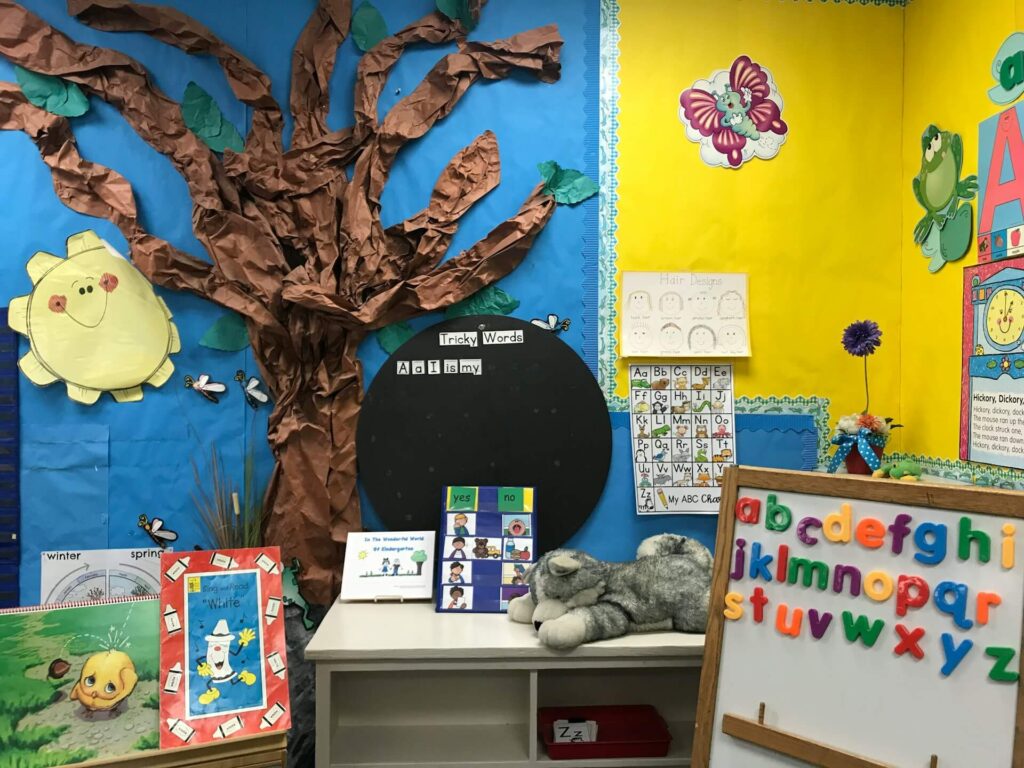
Sie gibt im Folgenden zehn Impulse für eine gute Schulentscheidung. Du kennst es schon: Ich fasse jeweils nur sehr kurz zusammen und empfehle bei Interesse die Seiten 288 ff. im Buch.
1. Unsere eigenen Ängste und Schulerfahrungen sollten wir so wenig wie möglich auf unser Kind übertragen.
2. Vertrauen wir darauf, dass Schule ein guter Ort sein kann.
3. Glauben wir unserem Kind, wenn es uns sagt, wie es ihm in der Schule geht.
4. Die Schule sollte nicht die Beziehung prägen, die wir zu unserem Kind haben.
5. Keine Angst vor Umwegen – ob wiederholte Klasse, schlechte Noten, Nachhilfe, Verweis oder Schulwechsel.
6. Das System ist durchlässig. Also keinen Stress mit dem Gymnasium, wenn es nicht zum Kind passt.
7. Unsere Kinder sind immer noch klein.
8. Schule darf keine Angst machen und Schule darf nicht schrecklich sein.
9. Kinder können vieles in ihrem Schulleben selber regeln.
10. Schule ist nicht das Wichtigste. Sie darf nicht unser Leben bestimmen (wenn auch unseren Aufwachrythmus…)
Manifest für eine selbstbestimmte Geburtskultur

Lehrkräfte und Sozialpädagog*innen
Im nächsten Abschnitt geht es um die Lehrkräfte und Sozialpädagog*innen: Natürlich wollen wir alle, dass sie möglichst bedürfnisorientiert und mit einer guten Bindung unsere Kinder begleiten. Doch Empathie ist keine Einbahnstraße. Wenn wir als Eltern mit diesen Menschen wertschätzend, freundlich und offen umgehen, hilft das umgekehrt auch dabei, dass genug Kraft für den Aufbau sicherer Bindungen da ist. Und außerdem sind auch Fachkräfte letztlich Menschen und machen Fehler. Gestehen wir ihnen diese Fehler zu.
Je deutlicher die Menschen, denen wir unser Kostbarstes anvertrauen, spüren, dass wir sie auch selbst als kostbare Menschen ansehen und nicht als Ressourcen, die wir einfach verbrauchen können, desto offener und vertrauensvoller werden sie auch unseren Kindern und uns begegnen.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 296f
Sollten wir tatsächlich Dinge bemerken, die wir ansprechen wollen, ist es nicht sinnvoll, alles in den Dreck zu ziehen, sondern Positives wie Negatives zu betonen. Mein Highlight:
Der drittletzte Abschnitt des Kapitels widmet sich der Frage, wie wir unsere Kinder einerseits vor Gefahren schützen können, während sie gleichzeitig ihre eigenen Erfahrungen machen können. Einen Großteil des Kapitels geht sie auf Sexualstraftäter*innen ein. Die entscheidende Frage dabei ist: „welche meiner Ängste sind begründet und berechtigt, welche vielleicht eher übertrieben?“ Sie betont, dass Kinder vor allem dann Opfer von manipulativen Erwachsenen werden, wenn sie selber besonders emotional bedürftig sind. Eine sichere Bindung hilft also, das Kind vor (körperlich gewaltlosen) Übergriffen zu schützen. Allerdings dürfe dieser Effekt auch nicht überschätzt werden, denn Kinder erleben in den besten Familien Krisenzeiten, die sie verletzlich machen.

Da die Verantwortung für einen Übergriff immer bei den Erwachsenen liegt, kann es helfen, zu wissen, wie diese Menschen vorgehen. Den Täter*innen geht es bei Missbrauch nicht um Liebe, sondern Macht. Es gibt nicht nur männliche Täter. Übergriffe sind oft langfristig geplant.
Wir als Eltern können unser Betreuungsnetz sorgfältig auswählen. Und wir sollten unseren Kindern den Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen erklären und deutlich machen: Nur Geheimnisse, die sich toll anfühlen, sollten Geheimnisse bleiben. Geheimnisse, die Bauchweh machen, sind schlechte Geheimnisse, und die dürfen und sollen sie mit uns teilen. Wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, sollten wir die Chance nutzen, uns außerdem professionell beraten lassen.
Genauso ist es aber wichtig, zu wissen: Die überwältigende Mehrheit aller Menschen hat keine bösen Absichten. Ein Generalverdacht hilft nicht. Im Gegenteil: Machen wir Kindern Angst, verlieren diese das Vertrauen, ihr Leben erleben zu können.
Im nächsten Abschnitt geht Nora Imlau auf Freundschaften unter Kindern ein. Dieser Abschnitt ist nochmal in Unterkapitel gegliedert. Besonders einprägsam war für mich der Satz, dass Kinder oft gar nicht so viel miteinander sprechen würden, das könnten sie schließlich auch mit Erwachsenen. Viel wichtiger sei für Kinder, was sie miteinander erlebten. Mit wem unsere Kinder sich anfreundeten, darauf hätten wir als Eltern übrigens nur sehr begrenzt Einfluss: Freundschaft, so die Autorin, lasse sich „weder erzwingen noch von außen herbeiführen.“ Die Bedeutung der Freundschaft ändere sich außerdem im Laufe der Zeit: Anfangs hätten Kinder ein „verhaltensbezogenes Konzept von Freundschaft“ (S.309). Ein Kind ist mit denjenigen Kindern befreundet, die mit ihm spielen und nett zu ihm sind. Außerdem spielt Regelmäßigkeit bereits eine Rolle: Eine Freundschaft entwickelt sich durch regen Kontakt. Freundschaften helfen Kindern außerdem, Regeln auszuhandeln und sich an diese zu halten. Und sie lernen den Unterschied zwischen Regelverstößen und unmoralischem Verhalten. Eine Regel gilt in einem bestimmten Kontext, und in diesem Kontext kann sie gebrochen werden. Unmoralisches Verhalten ist dagegen Verhalten, das wir nie gutheißen. Ich liebe das Beispiel aus dem Buch:
Im Kindergarten darf man am Tisch nicht pupsen, aber wenn man es trotzdem macht, ist es nicht so schlimm. Hauen ist aber immer verboten!
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 310
Im nächsten Unterkapitel geht die Autorin auf Kinderfreundschaften im Grundschulalter ein. Sie betont dabei, dass Kinder sich in diesem Alter schon eher miteinander vergleichen, was einerseits zu einer realistischeren Selbsteinschätzung, andererseits aber auch zu einem verminderten Selbstwertgefühl führt. In dieser Phase reicht die Versicherung durch andere Erwachsene nicht mehr aus. Auch andere Kinder werden zu einer Stütze des Selbstwertgefühls.
Folgend widmet sich Nora Imlau zwei sehr wichtigen Aspekten von Kinderfreundschaften: Einerseits den Problemen in solchen Freundschaften und andererseits Freundschaften entlang von Geschlechtergrenzen.
Um einen realistischen Blick auf Kinderfreundschaften zu erhalten, müssten vor allem wir als Erwachsene unsere romantischen Vorstellungen ablegen: Jede Freundschaft, egal in welchem Alter, kann sowohl förderliche als auch potenziell gefährliche Seiten haben. Als Eltern müssen wir den Blick schärfen, um zu merken, wann es die Kinder alleine hinbekommen, sich nach einem Streit wieder zu vertragen, und wann wir einschreiten und unser Kind schützen müssen.

Ich finde das die perfekte Überleitung zum Thema Geschlecht bei Kinderfreundschaften. Denn auch hier heißt es: Wir als Eltern sollten den Blick schärfen und unsere eigenen Vorstellungen nicht auf die Kinder übertragen.
Exkurs: Meine Tochter, ihre rosa Kleidchen und ich
(bitte zum Lesen aufklappen)
Ich überrasche euch wohl nicht damit, dass ich Feministin bin. Ich hätte mir nie vorgestellt, meine Tochter in rosa zu kleiden. (Meine Söhne hatten auch keine hellblaue Kleidung.) Aber hey, mittlerweile ist die Jüngste fast sechs und seit circa drei Jahren sortiert sie rigoros aus, was ihr an Kleidung nicht gefällt. Und ratet: Feuerwehrautos raus, Einhörner rein; blau raus (außer es glitzert), rosa rein. Und warum? Weil sie ein Mädchen ist und weil Mädchen nun mal so was tragen. (Privater Kotzmoment.)
Ich lasse sie machen, weil ich mir denke, dass genau das Feminismus ist: ALLE Kleidungsstücke sind für alle da. Pink, Glitzer, Einhörner für Mädchen; Pink, Glitzer, Einhörner für Jungs. Dinos, Army-Style, Feuerwehr für Jungs, Dinos, Army-Style, Feuerwehr für Mädchen.
Und meiner Tochter ist es gerade wichtig, so auszusehen wie andere Mädchen. Und die tragen nun mal Kleider.
Auch Nora Imlau berichtet im Buch von „holzschnittartigsten Geschlechterklischees“ (Seite 314). Zum Glück, so erklärt sie, müssten Kinder nicht für immer und ewig in diesen Klischees hängen bleiben, sondern würden durchaus wieder ein diverseres Bild von Geschlechtlichkeit entwickeln, solange sie diverse erwachsene Vorbilder haben. Unsere Hauptaufgabe als Eltern sei entsprechend, Kindern zu vermitteln, „dass es normal ist, verschieden zu sein“ (Seite 315).
Aus den nächsten Unterkapiteln möchte ich jeweils die für mich bedeutendsten Sätze zitieren. Zu jedem dieser Themen könnte man eigene Bücher schreiben, und wenn ihr euch mit einem der Themen auseinander setzen wollt, schaut gerne in die verlinkten Bücher – diese stammen allesamt aus der Literaturliste von „In guten Händen“.
Wie Kindergruppen funktionieren:
weil im Klassenzimmer und im Kindergarten, in der Musikschule und im Sportverein meist die Erwachsenen die Regeln vorgeben, lernen Kinder am meisten über Gruppen und deren Dynamiken in der Freizeit mit ihren Freund*innen.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 317
Beste Freund*innen:
Die besten Chancen, lebenslang Freund*innen zu bleiben, haben […] Kinder, deren Eltern sich ebenfalls miteinander angefreundet haben – und die sich dadurch bei Festen, Feiern oder sogar gemeinsamen Urlauben ganz automatisch immer wieder sehen und sich damit nicht aus den Augen verlieren können.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 321
Die Kunst, Freundschaften zu schließen:
Gute Mitspieler*innen müssen sich einbringen und zurücknehmen können, kreative eigene Ideen ebenso entwickeln wie aufnehmen, sich an Regeln halten und verlässlich sein.“
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 322
Wer sich dauerhaft verbiegt, um Partout Freundschaften zu haben, schwächt damit die eigene Fähigkeit, authentische und tragfähige Beziehungen einzugehen.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 324
Die dunkle Seite der Gleichaltrigen-Beziehung – Mobbing:
Mobbing ist das genaue Gegenteil von Freundschaft und hat dementsprechend auch den exakt entgegengesetzten Effekt: Das Kind wird in seinem Selbstwertgefühl geschwächt, in seiner Würde verletzt und in seinem Entwicklungspotential beschnitten.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 325
Das wichtigste Grundprinzip im Umgang mit gemobbten Kindern ist, ihnen nie auch nur eine Teilschuld an ihrer Opferrolle zuzuschreiben. […] Sie verdienen bedingungslosen Rückhalt und alle Unterstützung dabei, sich aus dieser leidvollen Situation zu befreien.
Nora Imlau: In guten Händen, Seite 327
Unterschiedliche Wertvorstellungen
Nach diesem recht langen Abschnitt geht die Autorin im nächsten Abschnitt auf unterschiedliche Wertvorstellungen ein. Sie betont, dass es für Kinder durchaus hilfreich sein kann, unterschiedliche Werte kennenzulernen, weil sich dann die eigenen Werte sehr viel bewusster entwickeln ließen. Wenn wir den Kontakt zum Kind zwar ermöglichen möchten, sich die Kinder aber nicht zu Hause treffen sollen, sollten Eltern kreativ werden: „Dann brauchen wir Ideen, etwa die, dass wir den Kindern ein gemeinsames Hobby weg von zu Hause […] ermöglichen oder sie mal gemeinsam in die Ferienbetreuung schicken.“ (Seite 329) Wir sollten unterscheiden zwischen den Eltern, mit deren Wertvorstellungen wir nicht übereinkommen, und den Kindern, die in diese Familie geboren werden, und die wir als Individuum ansehen sollten.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass wir als Eltern, wenn wir aufgrund unserer Hautfarbe nicht von Rassismus betroffen sind, dieses Privileg anerkennen und damit die Wahl haben, uns offenem oder verdecktem Rassismus in anderen Familien entgegenzustellen. Wir können aber auch entscheiden, es nicht zu tun. Diese Wahl haben rassifizierte Menschen nicht. Wir sollten deshalb unsere eigenen blinden Flecken genauer betrachten und wenn möglich auflösen, und uns andererseits Diskriminierungsversuchen entgegenstellen.
In der nächsten Rezension widme ich mich dem letzten Kapitel und schreibe eine persönliche Einschätzung des Buches.
No products found.
Wöchtenliche Updates zu neuen Beiträgen
Katharina Tolle
Wie schön, dass du hier bist! Ich bin Katharina und betreibe seit Januar 2018 diesen Blog zu den Themen Geburtskultur, selbstbestimmte Geburten, Geburtsvorbereitung und Feminismus.
Meine Leidenschaft ist das Aufschreiben von Geburtsgeschichten, denn ich bin davon überzeugt, dass jede Geschichte wertvoll ist. Ich helfe Familien dabei, ihre Geschichten zu verewigen.
Außerdem setze ich mich für eine selbstbestimmte und frauen*-zentrierte Geburtskultur ein. Wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, schreib mir gern!